Was sind zirkuläre Geschäftsmodelle?
Zirkuläre Geschäftsmodelle sind ein zentrales Element der Kreislaufwirtschaft. Sie zielen darauf ab, Ressourcen effizienter zu nutzen und Abfälle zu minimieren. Damit unterscheiden sie sich von linearen Geschäftsmodellen, bei denen Produkte am Ende ihres Lebenszyklus entsorgt werden.
Charakteristisch für zirkuläre Geschäftsmodelle ist die Förderung der Wiederverwendung und Wiederaufbereitung, aber auch die Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten und die intensivere Nutzung von Produkten durch flexible Eigentumsverhältnisse (Sharing). Die daraus entstehenden Wertschöpfungsmöglichkeiten führen zu einer signifikanten Reduzierung von Abfällen und einer besseren Nutzung von Rohstoffen.
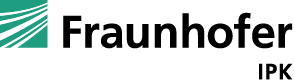 Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik