Vom Ende gedacht
Ab Februar 2027 wird der Batteriepass ein verpflichtender Begleiter jeder Traktions-, Zweirad- oder Industriebatterie über 2 kWh Kapazität. Als Pilot wird er eine Vorreiterrolle im Bereich digitaler Produktpässe (DPP) in der Europäischen Union einnehmen – Pässe für weitere Erzeugnisse wie Möbel, Spielwaren und anderes werden Schritt für Schritt folgen.
Hinter der Initiative steckt eine ganze Reihe ehrenhafter Ziele: Der Batteriepass soll Transparenz in der Batterieindustrie schaffen, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützen und nachhaltige sowie verantwortungsbewusste Lieferketten fördern. Dazu erfasst und verwaltet der Pass umfassende Informationen über eine Batterie. Das EU-weite Projekt »Battery Pass«, das unter Beteiligung des Fraunhofer IPK inhaltliche und technische Rahmenwerke und Empfehlungen für die Umsetzung des EU-Batteriepasses erarbeitet hat, hat eine Reihe von Kategorien an Informationen identifiziert, die ein Batteriepass umfassen sollte (vgl. Infokasten). Im Interesse der Datensouveränität werden diese Informationen im Batteriepass dezentral über Systeme bereitgestellt, die der Wirtschaftsakteur betreibt, der die Batterie in Verkehr bringt.
Die Vorteile warten am Lebensende
Seine Stärken spielt der Batteriepass nach Untersuchungen des Battery-Pass-Konsortiums insbesondere am Ende der Nutzungsdauer einer Batterie aus – in den Bereichen Sammlung, Wiederverwertung und Recycling von Batterien. So können Behörden durch detaillierte Informationen illegale Exporte und Entsorgungsmethoden besser verhindern, wodurch das sogenannte »Battery Leakage« – der Verlust von Batterien aus dem legalen Recyclingkreislauf – reduziert wird.
Auch die Bestimmung des Restwerts von Batterien wird durch den Pass vereinfacht. Dank umfassender Daten zu Leistung und Haltbarkeit können Unternehmen und private Nutzer den Wert einer Batterie genauer einschätzen. Dies reduziert nicht nur technische Testkosten, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass Batterien für Second-Life-Anwendungen weiterverwendet, anstatt direkt recycelt oder entsorgt werden.
Wo eine Weiternutzung nicht mehr möglich oder sinnvoll ist, unterstützt der Batteriepass ein effizienteres Recycling, da transparente Informationen über die Zusammensetzung und Anleitungen zur Demontage bereitgestellt werden. Dies senkt Kosten, zum Beispiel für Probenahmen, was zu einer insgesamt nachhaltigeren Verwertung führt.
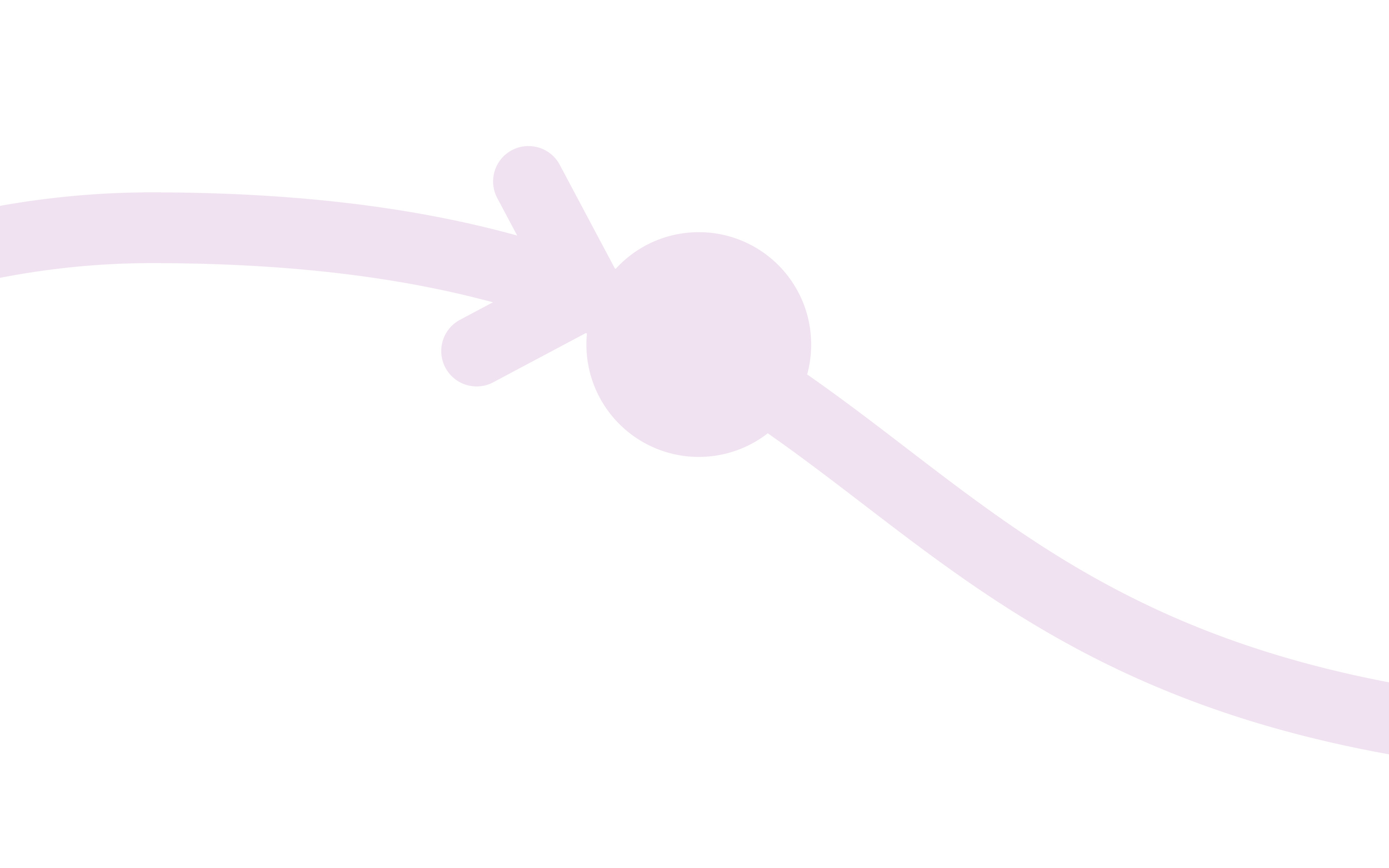
Firmenentscheidung: Pflicht oder Kür
Ob der Pass einer spezifischen Batterie so ausgelegt wird, dass er seine Stärken voll ausspielen kann, hängt von Entscheidungen ab, die beim Inverkehrbringer getroffen werden. Die Implementierung ist zwar verpflichtend, doch bei der Ausgestaltung gibt es Spielräume, die Unternehmen vor strategische Entscheidungen stellen. Diese wirken sich maßgeblich darauf aus, ob es bei einer Pflichtumsetzung bleibt oder der Inverkehrbringer die wirtschaftlichen Vorteile, die ein digitaler Produktpass mit sich bringt, effektiv nutzen kann.
Um sich optimal auf die Einführung vorzubereiten, empfiehlt das Battery-Pass-Konsortium, vier zentrale Fragen zu berücksichtigen:
1. Warten oder handeln?
Unternehmen müssen abwägen, ob sie frühzeitig handeln oder erst auf eine spätere Umsetzung setzen. Ein verzögerter Einstieg kann dazu führen, dass Kundenverträge oder Marktzugänge verloren gehen und durch eine verspätete Implementierung zusätzliche Kosten entstehen. Andererseits können unklare regulatorische Anforderungen oder unzureichende Lieferantendaten eine vorschnelle Umsetzung erschweren. Ein gezielter Kosten-Nutzen-Vergleich ist entscheidend, um den besten Zeitpunkt für die Einführung des Batteriepasses zu bestimmen.
2. Compliance oder geschäftlicher Mehrwert?
Unternehmen müssen entscheiden, ob der Batteriepass lediglich als gesetzliche Verpflichtung betrachtet wird oder ob er eine strategische Chance darstellt. Eine minimalistische Umsetzung reicht aus, um grundlegende Compliance-Anforderungen zu erfüllen, etwa durch die Erfassung von Daten zu Gesundheitszustand und Haltbarkeit. Wer jedoch auf detaillierte Daten setzt, beispielsweise zur Überwachung der Lieferketten, Produktionsprozesse und Zirkularität, kann durch eine verbesserte Transparenz die Effizienz steigern und neue Geschäftsmodelle erschließen.
3. Selbst entwickeln oder externe Lösung nutzen?
Unternehmen stehen vor der Wahl, ob sie den Batteriepass intern entwickeln oder externe Anbieter nutzen. DPP-Dienstleister und Konsortien wie Catena-X bieten bereits standardisierte Lösungen an. Große Unternehmen mit ausreichenden Kapazitäten können eigene Inhouse-Lösungen entwickeln, um maßgeschneiderte Mehrwerte zu generieren. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) hingegen könnten davon profitieren, die Umsetzung an externe Anbieter auszulagern, um Kosten und Komplexität zu reduzieren. Zudem bieten Datenökosysteme Möglichkeiten, den notwendigen Datenaustausch entlang der vorgelagerten Wertschöpfungskette zu realisieren.
4. Bestehende Infrastruktur oder Neustart?
Die bestehende IT- und Dateninfrastruktur ist für die Einführung des Batteriepasses von entscheidender Bedeutung. Einige Unternehmen verfügen bereits über Systeme, die eine Vielzahl relevanter Daten erfassen und verwalten, was den Übergang erleichtert. Wer ohne eine solche Basis startet, sieht sich häufig mit hohem Investitions- und Implementierungsaufwand konfrontiert. Bleibt man jedoch bei älteren Systemen, besteht das Risiko, dass diese nicht auf zukünftige Anforderungen ausgelegt sind. Die Einführung eines Batteriepasses bietet die Chance, gewachsene IT-Strukturen neu zu denken und mit einem umfassenden Digitalisierungsansatz zukunftsfähige Lösungen zu etablieren.
Datenökosysteme für unternehmensübergreifenden Datenaustausch
Soll das volle Potenzial von digitalen Produktpässen ausgeschöpft werden, bietet es sich an, das ganzheitliche Konzept der Datenökosysteme als Basis für die Ausgestaltung zu wählen – immerhin ist ein DPP im Kern ein Datenhub. Datenökosysteme sind komplexe Netzwerke, in denen Daten als wertvolle Ressource betrachtet werden, die von verschiedenen Akteuren erzeugt, geteilt und verarbeitet werden. Zu den Akteuren gehören Datenproduzenten, -verarbeiter und -konsumenten, die in einem dynamischen Austausch stehen.
Die Besonderheit und Stärke von Datenökosystemen ist der sogenannte Föderationsansatz: Daten werden in verteilten Systemen gespeichert und verarbeitet, anstatt in zentralisierten Datenbanken. Dieser Ansatz ermöglicht es, Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren, während die Datenhoheit der einzelnen Akteure gewahrt bleibt und sie die Kontrolle darüber behalten, wer wann wie auf welche ihrer Daten zugreift. Durch die Nutzung von Schnittstellen und standardisierten Protokollen können verschiedene Organisationen und Systeme miteinander kommunizieren und Daten austauschen, ohne dass die Datenbestände zentralisiert werden müssen. Das fördert nicht nur die Zusammenarbeit und den Datenzugriff, sondern stärkt auch das Vertrauen zwischen den Beteiligten, da sie die Kontrolle über ihre eigenen Daten behalten.
Initiativen leisten Grundlagenarbeit
Eine ganze Reihe von Projekten arbeitet mittlerweile daran, Lösungen für Datenökosysteme bereitzustellen. Das Fraunhofer IPK ist bei einigen federführend beteiligt. GAIA-X ist ein zentrales Element in der Entwicklung von Datenökosystemen in Europa. Es schafft eine vertrauenswürdige und interoperable Infrastruktur, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten sicher zu teilen und zu nutzen. Mit GAIA-X wird eine Plattform geschaffen, die den Austausch von Daten und Services zwischen verschiedenen Sektoren erleichtert und gleichzeitig die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards gewährleistet. Durch die Förderung von Offenheit und Zusammenarbeit zielt GAIA-X darauf ab, eine nachhaltige digitale Wirtschaft zu unterstützen und die digitale Souveränität Europas zu stärken.
Catena-X stellt eine erste Umsetzung eines Datenökosystems für die Automobilindustrie dar, das auf der Grundlage von GAIA-X entwickelt wurde. Dieses Datenökosystem kann als Basis für den datensouveränen Austausch von Informationen dienen, einschließlich solcher, die sich auf Batterien beziehen. Um den Austausch von Batterieinformationen zu ermöglichen, existieren im Datenökosystem standardisierte Datenmodelle, die einen interoperablen Austausch zwischen den Unternehmen sicherstellen. Darüber hinaus werden in dem Datenökosystem Grundlagen geschaffen, um den Austausch der Daten auf bestimmte Parteien und bestimmte Anwendungsfälle zu beschränken.
Die Projektfamilie Manufacturing-X hat das Ziel, Lösungen aus Catena-X auf andere Branchen zu übertragen. Ein spezifisches Projekt innerhalb dieser Familie ist Aerospace-X, das sich mit der Luftfahrtindustrie beschäftigt. Im Rahmen dieses Projekts werden neben der allgemeinen technischen Infrastruktur und den Services zur Umsetzung des Datenökosystems vier Anwendungsfälle betrachtet: Kapazitätsmanagement, Ökobilanzierung und Product Carbon Footprint (PCF), Kreislaufwirtschaft sowie End-to-End-Qualitätsmanagement. Für die Umsetzung dieser Anwendungsfälle sind Informationen aus der Lieferkette erforderlich. Insbesondere für die Ökobilanzierung (LCA) werden Daten wie Energieverbräuche aus der Produktion oder dem Transport sowie die Einflüsse bei der Bearbeitung von Materialien herangezogen, die von Partnern in der frühen Lieferkette stammen. Zudem können die Materialinformationen auch zur Auswahl passender Entscheidungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft verwendet werden.
All diese Initiativen machen eine nachhaltige Datenzukunft möglich, die Daten als das wertschätzt, was sie sind: ein Rohstoff für Unternehmenserfolg. In diesem Kontext werden digitale Produktpässe künftig einen maßgeblichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen leisten.
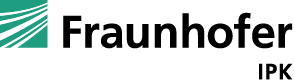 Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik