Das am Fraunhofer IPK entwickelte Automation Assessment hilft Unternehmen, diese Frage zu beantworten und Automatisierungspotenziale auszuloten.
Die Zahl der Industrieroboter steigt weltweit von Jahr zu Jahr. Knapp 600 000 Roboter wurden im Jahr 2023 verkauft. Der Trend wird sich nach den Prognosen von Statista weiter fortsetzen. Neben der Handhabung und Montage werden Roboter zunehmend in der Fertigung eingesetzt, nämlich überall dort, wo Produktionslinien kurzfristig angepasst werden müssen. Gerade im Zusammenspiel mit dem Menschen entfalten Roboter ihr Potenzial. Ob bei der Maschinenbeschickung, der Bearbeitung von Bauteilen oder der Qualitätskontrolle – die sogenannte Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) kombiniert die Vorteile von manueller und automatisierter Arbeit und ermöglicht es Unternehmen, ihre Produktion flexibler zu gestalten.
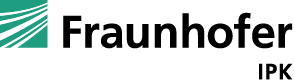 Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik

