Elf Maschinen, ein Ziel
83. Minute, es steht 1:1 – die entscheidende Schlussphase. In den letzten Minuten eines Fußballspiels sind Reaktionsvermögen und Flexibilität entscheidend für den Erfolg. Die Heimmannschaft greift noch einmal an. Dabei muss auch der ein oder andere riskante Spielzug in Kauf genommen werden. Nach einigen Pässen landet der Ball schließlich beim Stürmer, er muss nur noch den gegnerischen Torwart überwinden – und dann liegt der Ball im Netz. Während das Team auf dem Platz feiert, jubeln der Trainer auf der Bank und die Geschäftsführung des Vereins auf der Tribüne mit.
Genauso wie auf dem Fußballplatz müssen auch in einem komplexen, sich teilweise schnell wandelnden Produktionsumfeld – mit Maschinen und arbeitenden Menschen, aber auch verschiedenen Abteilungen und Geschäftsfeldern – alle Akteure eng zusammenarbeiten. Durch effektive Kommunikation zwischen den Akteuren kann die Produktivität auf höchstem Niveau und die kontinuierliche Fertigung am Laufen gehalten werden, damit hochwertige Endprodukte entstehen. Trotz des gemeinsamen strategischen Ziels können die Beteiligten situationsbedingt unterschiedliche Prioritäten haben: Die Produktion strebt beispielsweise nach maximaler Effizienz und Auslastung, während die Instandhaltung darauf bedacht ist, die Maschinen durch regelmäßige Wartung und Inspektionen in einem optimalen Zustand zu halten.
Der Gesamterfolg hängt damit nicht nur von der Leistung oder dem Zustand der einzelnen Akteure ab, sondern vor allem von ihrer nahtlosen Zusammenarbeit. Genau wie beim Fußball, wo es auf Aufstellung, taktische Ausrichtung, einstudierte Abläufe, aber auch das Reaktionsvermögen auf immer neue Spielsituationen ankommt, müssen alle Beteiligten, von der Produktentwicklung bis zur Logistik, aufmerksam und transparent miteinander kommunizieren. Nur so können potenzielle Störungen oder Schwachstellen frühzeitig erkannt und behoben werden.
Auch die Fitness der einzelnen Spieler oder Spielerinnen und das Equipment muss im Fußball stimmen, damit über eine ganze Saison hohe Leistung erbracht und schließlich ein guter Tabellenplatz erreicht werden kann. Auch Auswechslungen und das Schonen besonders wichtiger Teammitglieder gehören im Profisport dazu. Übertragen auf den Produktionskontext sind regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen an Maschinen und Anlagen unerlässlich. Doch genau hier entsteht ein klassischer Zielkonflikt zwischen einer unterbrechungsfreien Produktion und notwendiger Instandhaltung.
Dieser Konflikt ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern kann auch über den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens entscheiden: minimale Ausfallzeiten, gleichzeitig die Gefahr von größeren Schäden und Produktionsausfällen durch unzureichende Wartung – ein Balanceakt mit erheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen. Verzögerte Wartungen führen oft zu ungeplanten Stillständen, die Kosten in die Höhe treiben und Liefertermine gefährden. Gleichzeitig kann eine ungeschickte Wartungsplanung die Effizienz der Produktion beeinträchtigen.
Inspiriert durch den Menschen
Zur Lösung dieses Zielkonflikts ist im Fraunhofer-Leitprojekt EMOTION das entscheidende Stichwort Empathie. Was als grundlegendes psychologisches Konzept den Zusammenhalt von menschlichen Gemeinschaften stärkt und Kollaboration fördert, verhilft im besten Fall der Fußballmannschaft zum Sieg – und kann im Umfeld komplexer Produktionssysteme die Kooperation zwischen Maschinen und mit dem Menschen effizienter, effektiver und robuster machen.
Forschende am Fraunhofer IPK entwickeln hierzu das Konzept eines empathischen technischen Systems. So könnte beispielsweise ein mobiler Roboter die Ziele und Steuergrößen anderer Roboter verstehen und proaktiv unterstützen, indem er seine eigene Rolle flexibel anpasst. Oder eine Werkzeugmaschine erkennt die Dringlichkeit von Produktionsaufträgen und passt ihre Arbeitsabläufe autonom an, um diese effizient zu erfüllen. Solche Systeme ermöglichen es Maschinen, miteinander zu kommunizieren, sich gegenseitig zu unterstützen und dynamisch auf Herausforderungen zu reagieren.
Was heißt eigentlich Empathie?
EMOTION unterscheidet drei zentrale Formen der Empathie, die das Verhalten eines Menschen im Umgang mit anderen prägen: Kognitive Empathie beschreibt die Fähigkeit, die Gedanken und Perspektiven eines anderen zu verstehen, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen und zu erkennen, was dieser möglicherweise denkt oder benötigt. Affektive Empathie geht einen Schritt weiter und bezieht sich auf das Erkennen und Miterleben der emotionalen Zustände anderer. Mitfühlende Empathie schließlich führt die gewonnenen Erkenntnisse zu einer proaktiven Handlung zusammen, um auf das Verständnis und die Wahrnehmung anderer zu reagieren und Unterstützung anzubieten.
Diese Differenzierung der Empathiearten bildet die Grundlage, um Anforderungen an empathische technische Systeme zu definieren und sie dazu zu befähigen, ähnlich wie Menschen in sozialen Interaktionen zu agieren – mit dem Ziel, Zielkonflikte in der Produktion frühzeitig zu erkennen und effizient zu lösen.
Ziel von EMOTION ist es dabei, alle Akteure eines Produktionssystems auf die Stufe der mitfühlenden Empathie zu heben. Das hieße etwa, dass Maschinen nicht nur in der Lage sind, die Ziele und Prioritäten anderer Maschinen oder Systeme kognitiv zu erfassen. Empathische technische Systeme sollen in der Vision von EMOTION auch mehr leisten, als die »Stimmung« oder den Zustand anderer Systeme nur affektiv zu erkennen – etwa, wenn eine Maschine durch intensive Nutzung »gestresst« ist und daraufhin ihre Leistung gedrosselt wird, um Überlastungen zu vermeiden. Wenn Maschinen in Zukunft auch mitfühlend empathisch agieren, können sie erkennen, dass eine andere Maschine bald ausfällt, zur Entlastung proaktiv Aufgaben übernehmen oder den Wartungsprozess initiieren, um einen Produktionsstillstand zu verhindern.



Empathische Kooperation in der Praxis
Wie die Integration von empathischen Systemen in der Praxis funktioniert, zeigt ein Beispiel aus der Produktion: Zwei Werkzeugmaschinen arbeiten parallel an unterschiedlichen Fertigungsaufträgen. Eine dieser Maschinen bemerkt durch ihre integrierten Sensoren und Analysemethoden einen zunehmenden Werkzeugverschleiß. Dieser drohende Verschleiß erfordert baldige Wartungsmaßnahmen, doch die Heraus-forderung besteht darin, diese Wartung so zu planen, dass der laufende Produktionsprozess nicht unterbrochen wird.
In diesem Szenario tritt zunächst die Maschine-Maschine-Interaktion in den Vordergrund. Die »mitfühlende« Maschine in einwandfreiem Zustand erfragt mithilfe ihrer Software den Zustand ihrer verschleißgefährdeten Nachbaranlage. Gemeinsam analysieren sie die Situation: Die funktionierende Maschine bewertet die Dringlichkeit der noch ausstehenden Aufträge und ermittelt mit der anderen Maschine, welche Aufträge sicher abgeschlossen werden können und welche Aufgaben umverteilt werden müssen, um die Wartung effizient zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich nicht um einen einfachen Datenaustausch, sondern um eine tiefere Form der Kommunikation, bei der die Maschinen kontextbezogene Entscheidungen treffen und sich gegenseitig in ihren Funktionen unterstützen.
Doch diese autonomen Entscheidungen der Maschinen unter sich sind nur der erste Schritt. Der Mensch, in diesem Fall eine erfahrene Instandhaltungsfachkraft, wird in den Prozess eingebunden, sobald die Maschinen ihre Analysen abgeschlossen haben. Die Maschinen übermitteln ihre Entscheidungsvorschläge an die Fachkraft, die nun ihre Prozessexpertise einbringen kann. Sie überprüft die von den Maschinen vorgeschlagenen Maßnahmen, berücksichtigt dabei die Gesamtproduktion und mögliche Risiken und passt die Wartungsplanung gegebenenfalls an. Durch diese Mensch-Maschine-Interaktion werden die maschinellen Vorschläge verifiziert und mit der menschlichen Erfahrung und dem Wissen über den gesamten Produktionsprozess ergänzt.
Menschen spielen dabei eine zentrale Rolle, auch wenn Maschinen immer intelligenter und integrierter zusammenarbeiten: Nicht nur muss die Wartung physisch von Menschen durchgeführt werden, sie müssen auch darüber entscheiden, welche der vorgeschlagenen Maßnahmen wann erfolgen soll, um die Produktion so wenig wie möglich zu stören. Dabei interagieren die beteiligten Menschen kontinuierlich mit den Maschinen, indem sie ihre Zustandsmeldungen und Vorschläge überwachen, ihre Entscheidungen validieren und notwendige Anpassungen vornehmen. Der Mensch wird so zum Dirigenten eines orchestrierten Zusammenspiels zwischen den Maschinen, das darauf abzielt, den Produktionsprozess optimal zu gestalten.
Diese enge Interaktion führt zu einer verbesserten Flexibilität und Effizienz im Produktionsprozess und damit auch zum notwendigen zeitlichen Spielraum für Instandhaltungsmaßnahmen. Die Maschinen übernehmen dabei den Part der vorausschauenden Planung und autonomen Entscheidungsfindung, während Menschen als strategische Leiter agieren und sicherstellen, dass die Vorschläge der Maschinen mit den übergeordneten Produktionszielen und den praktischen Erfordernissen übereinstimmen.
Sind Wartungsmaßnahmen notwendig, wird die Neuplanung der Aufträge, die eine Technikfachkraft basierend auf den maschinellen Analysen und ihrer eigenen Expertise vornimmt, sofort an das Materialflusssystem weitergeleitet. Diese synergetische Kooperation zwischen Mensch-Maschine und Maschine-Maschine zeigt, wie die Integration empathischer Systeme in Produktionsumgebungen auch menschliche Expertise optimal nutzt.
Die Fabrik der Zukunft
Produktionssysteme, deren Akteure miteinander kommunizieren und kooperieren, gewährleisten einen störungsfreien Betrieb – selbst in unvorhergesehenen Situationen. Diese innovativen Technologien bieten Unternehmen einen entscheidenden Vorteil und zeigen, wie die Fabrik der Zukunft resilienter, dynamischer und leistungsfähiger gestaltet werden kann. Mit diesen Entwicklungen aus dem Fraunhofer-Leitprojekt wird ein neuer Weg beschritten: hin zu einer Industrie, in der Maschinen nicht nur Werkzeuge sind, sondern zu intelligenten Partnern des Menschen werden, die den Erfolg eines Unternehmens nachhaltig sichern.
Fraunhofer-Leitprojekt EMOTION
Auch in der Forschung ist die enge Zusammenarbeit mit Partnern unerlässlich – sei es in Industriekooperationen oder Forschungsverbünden. Erfolgreich können große Projekte nur sein, wenn man die Bedürfnisse der beteiligten Partner kennt.
Genau dies zeigt das Fraunhofer-Leitprojekt EMOTION: Seit 2023 forschen sieben Fraunhofer-Institute an einer gemeinsamen Zukunftsvision, in der Maschinen aufeinander achten und sich im Ernstfall gegenseitig unterstützen. Sogenannte empathische Produktionssysteme sollen eine effizientere und resilientere Kooperation der verschiedenen Akteure in der Produktion ermöglichen – das gilt für die zunehmend intelligenter werdenden Maschinen untereinander, vor allem aber für die Integration des Menschen in komplexe Produktionssysteme.
Beteiligt sind:
- Fraunhofer Austria (fraunhofer.at)
- Fraunhofer-Institute für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO (iao.fraunhofer.de)
- Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF (iff.fraunhofer.de)
- Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML (iml.fraunhofer.de)
- Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS (fokus.fraunhofer.de)
- Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK (Koordinator) (ipk.fraunhofer.de)
- Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP (izfp.fraunhofer.de)
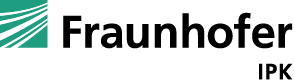 Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
