Der Mix macht’s
FUTUR: Sie alle beschäftigen sich mit neuen Antriebstechnologien. Welche Antriebsformen werden sich Ihrer Ansicht nach durchsetzen und warum?
Uhlmann:
Wir beschäftigen uns intensiv mit dieser Frage, insbesondere in Bezug auf Energieeffizienz und Klimaneutralität von Automobilfahrzeugen. In Deutschland wurde die Elektromobilität in den letzten Jahren mit großer Vehemenz vorangetrieben, jedoch ohne die notwendige Infrastruktur in ausreichendem Maße mitzudenken. Der Automobilindustrie wurde im Prinzip ein Geschenk gemacht, indem viele elektrische Technologien subventioniert wurden, selbst solche, die nicht unbedingt hilfreich und im besten Fall eine Brückentechnologie sind. Hybridfahrzeuge, zum Beispiel, verbrauchen viele Ressourcen und machen Fahrzeuge schwerer, ohne dass sie vollständig elektrisch betrieben werden können.
Um die Effizienz und Umweltverträglichkeit der verschiedenen Antriebstechnologien einschätzen zu können, muss man deren Wirkungsgrad und CO2-Emissionen betrachten. Wir haben das für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV), Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV), Wasserstoffdirektverbrenner und Verbrennungsmotoren mit E-Fuels und Benzin getan. Unsere Analysen zeigen, dass batteriebetriebene E-Fahrzeuge den höchsten Wirkungsgrad haben, gefolgt von Brennstoffzellenfahrzeugen. Wasserstoffdirektver-brennung und E-Fuels sind dagegen alternative Technologien.
Schwarz:
Wie haben Sie das berechnet?
Uhlmann:
Wir sind von einem Pkw der Mittelklasse ausgegangen und haben den CO2-Ausstoß des Fahrzeugs sowohl im Betrieb als auch in der Produktion berechnet. Die Emissionen in der Herstellung beziehen sich auf den gesamten Lebenszyklus eines Pkw bei einer angenommenen Lebensfahrleistung von 150 000 km. Die Emissionen im Betrieb haben wir anhand des Stroms berechnet, der zur Kraftstoffherstellung benötigt wird und dabei den aktuellen Strommix in Deutschland berücksichtigt. Bei unserer Betrachtung von E-Fuels sind wir von 100 Prozent reinen E-Fuels ausgegangen – momentan dürfen sie in der Luftfahrt nur minimal beigemischt werden.
Schwarz:
Das ist unterschiedlich, es gibt gegenwärtig zehn international zugelassene Produktionspfade für die Herstellung von SAF – Sustainable Aviation Fuels für die Luftfahrt und die Beimischungsquoten reichen von fünf bis 50 Prozent. Das ist aber eher eine politische als eine technische Frage, denn 50 Prozent Beimischungsquote sind mit der Fischer-Tropsch-Synthese seit Jahrzehnten möglich. Zwischen 50 oder 100 Prozent ist es eine Frage der Dichtung bei bestehenden Flugzeugen. Neue Flugzeuge, die heute produziert werden, können schon mit 100 Prozent E-Fuels fliegen. Aber ein Flugzeug hat eine durchschnittliche Laufzeit von 30 Jahren. Das heißt, für Bestandsflugzeuge werden noch 30 Jahre lang Kraftstoffe mit einer geringeren Beimischungsmenge benötigt.
Aber Sie sprachen schon die Infrastruktur an: Wieviel Strom haben wir denn zur Verfügung? Wir sind als EDL seit vier Jahren im Antragsprozess für ein Important Project of Common European Interest (IPCEI), das nennt sich »LHyVE – Leipzig Hydrogen Value Chain for Europe.« Hier wollen wir zusammen mit der VNG AG, der ONTRAS Gastransport GmbH und den Stadtwerken Leipzig die gesamte Wertschöpfungskette zu Erzeugung, Speicherung, Transport, Verteilung, Endverbrauch von grünem Wasserstoff in der Region Leipzig realisieren und über die Infrastruktur mit europäischen Projekten, Städten und Kommunen vernetzen. Konkret planen wir, 50 000 Tonnen E-Fuels und 15 000 Tonnen grünen Wasserstoff im Jahr zu produzieren. Wenn wir eine Klimaneutralität in Mobilität und Logistik erreichen wollen, brauchen wir grünen Wasserstoff. Der ist nach Ihrer Rechnung aber nicht mehr grün.

Uhlmann:
Brennstoffzellenfahrzeuge oder Wasserstoffdirektverbrenner verursachen beim heutigen Strommix im Betrieb noch recht hohe Emissionen, das ist richtig, weil Wasserstoff erzeugt werden muss. Können wir ihn viel besser herstellen, als wir es heute tun? Wenn wir anstatt den Überschussstrom aus Windrädern kostenpflichtig an Nachbarländer abzugeben, ihn nutzen um mit Elektrolyseuren Wasserstoff zu produzieren, dann vielleicht ja.
Schwarz:
Es ist eine Illusion zu glauben, dass man den Überschussstrom in die Elektrolyseure einbringt. Das kann ich Ihnen an einer einfachen Rechnung erklären: Erstens, was kaum einer weiß, jeder Windkraftanlagenbetreiber bekommt 95 Prozent der Vergütung, auch wenn die Windräder stehen. Zweitens: Die EU fordert die Einhaltung einer Reihe von komplexen Strombezugskriterien für den Betrieb von Elektrolyseuren für die Produktion von grünem Wasserstoff, die im Ergebnis die Laufzeiten der Elektrolyseure in Deutschland auf unter 3000 bis 4500 Betriebsstunden im Jahr drücken. Elektrolyseure können aber prinzipiell gut 8400 Stunden im Jahr laufen und sich so leichter amortisieren. Das bedeutet im Ergebnis, dass der so gewonnene grüne Wasserstoff zwischen 3- und 4-mal teurer ist. Diese Differenz bezahlt Ihnen heute aktuell niemand.
Uhlmann:
Genau, aber das ist ein politisches bzw. regulatorisches Problem.
Schwarz:
Dieses Narrativ von »Überschuss-Strom« hat aber tiefsten Eingang in die Politik, die Ministerien und Verwaltungen gefunden. Wenn man die Ökonomie ausblendet, finden Prozesse in der Wirtschaft nicht statt. Dann werden bestimmte Technologien nicht gefördert.
Blumenröder:
Ich gebe Ihnen recht, die Politik lässt die Stromerzeugung und Infrastruktur außen vor. Um Technologien zu bewerten, brauchen wir eine Betrachtung, die auch in ihren Prämissen vergleichbar ist, damit sie für politische Empfehlungen nutzbar ist. Dann hätte man nicht diesen entzweiten Weg zwischen technischen Lösungen mit entsprechender Effizienz einerseits und der politischen Vorgehensweise, Technologien zu fördern andererseits. Ingenieure müssen die Physik betrachten. Das kann ich nur empfehlen. Jeder andere Weg wäre der falsche.
Uhlmann:
Dann betrachten wir doch die technischen Fakten: Mit dem aktuellen Strommix müssen wir leben. Sofort auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzuschwenken, ist unrealistisch. Dann bedeutet das, dass wir sowohl bei Brennstoffzellen als auch bei der Wasserstoffdirektverbrennung im Betrieb durch die notwendige Wasserstofferzeugung höhere Kosten haben. Die Herstellungskosten für die Fahrzeuge sind ähnlich wie beim Benziner, auch wenn zum Teil andere Werkstoffe benötigt werden. Brennstoffzellenfahrzeuge und Wasserstoffdirektverbrenner sehe ich deshalb als Zwischenlösung.
E-Fuels sind in meinen Augen eine weitere, in der Herstellung aber derzeit teure alternative Technologie, da sie hohe Energiekosten verursachen und viel CO2 emittieren können. Ich glaube auch nicht, dass die aktuelle Produktion von E-Fuels ausreicht, um den Bedarf insbesondere in der Luftfahrt zu decken.
Das heißt also, überwiegend vollelektrische Fahrzeuge sollten schon das Ziel sein, aber nicht heute und auch nicht morgen, sondern wir müssen stufenweise dahin kommen. Das wird deutlich, wenn man berechnet, was wir an Strom bräuchten, wenn die 45 000 000 Fahrzeuge, die heute in Deutschland auf den Straßen unterwegs sind, alle elektrisch wären. Wir haben hierzulande einen Energiebedarf von 100 Terawatt. Ein Sechstel davon wäre nötig, um alle Fahrzeuge mit Strom zu bedienen. Das kriegen wir gar nicht hin. Deswegen brauchen wir Zwischentechnologien.
Schwarz:
Wir benötigen die Zwischentechnologien noch aus einem anderen Grund, da sind wir bei der Luftfahrt. Keiner wirft ein funktionierendes Flugzeug weg, man muss die Restlaufzeit mit einrechnen. Auch die Milliarden Autos, die heute auf der Welt herumfahren, haben alle eine Restlaufzeit, die man berücksichtigen muss.
Blumenröder:
Vielleicht hilft es, wenn wir in unserer Diskussion auf die Anwendung schauen, weil ohne Anwendung kein Nutzen entsteht. Batterieelektrische Antriebe finden im Straßenverkehr, insbesondere im Pkw- und Nutzfahrzeugbereich eine gute Verwendung. 80 bis 90 Prozent der Anwendungsfälle sind hiermit abgedeckt – die nötige Infrastruktur zum Laden und natürlich die regenerative Stromerzeugung vorausgesetzt. Wasserstoff-Brennstoffzellen: Wasserstoff als Energieträger ist vor allem in Bereichen sinnvoll, in denen Batterien aufgrund von Gewicht und Ladezeiten nicht ideal sind. Das Handling von Wasserstoff, insbesondere die Speicherung ist sehr energieaufwendig und sicherheitsrelevant.

Uhlmann:
Beim Speichern sind wir heute in der Lage, über CFK-Hochdruckbehälter bis 800 bar zu erreichen. Die Behälter sind entsprechend beschichtet, sodass die Reinheit des Wasserstoffs auch gewährleistet bleibt. Damit ist das Problem theoretisch gelöst.
Blumenröder:
Theoretisch, stimmt. Hinzu kommt aber noch ein anderes technisches Problem, das mit einer potenziellen Vergiftung der Brennstoffzelle zu tun hat, wenn die erforderliche Reinheit des Wasserstoffs nicht vorhanden ist. Unreinen Wasserstoff kann ich nicht in einer PEM-Brennstoffzelle verwenden. Wer nicht 99,99997 Prozent Reinheit erreicht, kann diesen Technologiepfad nicht nutzen. Kein Anbieter eines kommerziellen Brennstoffzellensystems lässt sich darauf ein, ein Zehntel Prozent von diesem Reinheitsgrad ins Risiko zu gehen. Also Wasserstoff in der Brennstoffzelle zu nutzen, wird ein ganz schmaler Anwendungsweg sein.
Polte:
Ein Punkt, den ich mit Blick auf die OEMs ergänzen möchte: Hinter jedem Antriebskonzept steckt eigentlich ein neues Auto. Strukturell sehen die Fahrzeuge ganz unterschiedlich aus, auch wenn sie sich vielleicht äußerlich ähnlich sind. Wir werden nicht auf einen Schlag alle Fahrzeuge mit einem neuen Antriebskonzept ausstatten können, sondern müssen die Bestandsfahrzeuge mit im Blick haben.
Blumenröder:
Ja, natürlich. In der Luftfahrt und im Straßenverkehr gibt es eine Bestandsflotte, die man bedienen muss. Es gibt aber andere Industriebereiche wie die Schifffahrt, die mit dem Thema Bestand deutlich innovativer umgehen. Wasserstoff herzustellen ist notwendig und wichtig für ganz viele Produkte, für die E-Fuels, für die Direktverbrennung, für die Brennstoffzelle. Das steht außer Frage. Aber wir müssen ihn speichern und wir müssen ihn transportieren können. In der Schifffahrt ist der Transport von Wasserstoff über große Entfernungen ökonomischer Unsinn.
Die internationale Schifffahrtsorganisation (IMO) hat Methanol und Ammoniak als die künftigen Schifffahrtskraftstoffe definiert. Beide Kraftstoffe bieten erhebliche Vorteile im Transport und in der Speicherung gegenüber Wasserstoff. Und sie lassen sich in ihren grünen Varianten in Brennstoffzellen, aber auch in Verbrennungsmotoren CO2-neutral verbrennen. Beide Kraftstoffe sind im Übrigen schon heute in der chemischen Industrie und in der Landwirtschaft sehr weit verbreitet, ihre Herstellung ist großindustriell abgesichert. Fast alle asiatischen Firmen arbeiten mit Methanol.
Schwarz:
Als »Rohstoffmann« möchte ich ergänzen: Ammoniak und Methanol sind sogenannte Global Trading Commodities. Die gibt es seit 120 Jahren, da existiert ein weltweites Handelssystem. Es gibt ein Pricing-System und es gibt einen Markt, der funktioniert.
Blumenröder:
Es gibt 120 Häfen in der Welt, in denen Methanol und Ammoniak verarbeitet wird. Und zwar in Mengen, die wir uns nicht vorstellen können. Der weltweite Ammoniakbedarf beträgt ungefähr 200 000 000 Tonnen. Somit ist Ammoniak mit das am meisten produzierte chemische Produkt auf der Welt.

Uhlmann:
Um auf den Automobilbereich zurückzukommen, was muss ich an dem Motor und an den Aggregaten in einem Fahrzeug ändern, um Ammoniak als Treibstoff zu verwenden?
Blumenröder:
Der Hubkolbenmotor ändert sich im Wesentlichen nicht. Man kann den Motor so konfigurieren, dass man beispielsweise Ammoniak ins Saugrohr einbringt und mit Wasserstoff anreichert. Aber Ammoniak im Pkw oder Lkw bringt ganz andere Herausforderungen mit sich. Ammoniak ist giftig und korrosiv, was zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für die Fahrzeuge selbst, aber auch für die Lagerung und den Transport von Ammoniak erfordert. Die Infrastruktur für die Nutzung von Ammoniak als Brennstoff ist noch in der Entwicklung.
Polte:
Also sind batteriebetriebene Elektrofahrzeuge kurzfristig eine gute Lösung. Wir können die Infrastruktur relativ einfach nachziehen. Viele Städte arbeiten bereits zum Beispiel mit Laternenladestationen für E-Fahrzeuge.
Blumenröder:
Wenn wir in Europa einen Durchdringungsgrad von 30 oder 40 Prozent für batterieelektrische Fahrzeuge erreichen wollen, dann reden wir über Jahrzehnte.
Polte:
Das sind auch die Informationen, die uns vorliegen. Allein beim Thema Elektromotor beziehungsweise Achsfertigung reichen die im Markt verfügbaren Kapazitäten gar nicht aus, um den Bedarf zu decken.
Schwarz:
Die Marktkapazitäten kann ich in fünf bis zehn Jahren hochfahren. Ich möchte einen Punkt aus der Rohstoffwirtschaft einwerfen: Wo kommen eigentlich die Metalle her, die benötigt werden, um Batterien zu bauen? Die gibt es nämlich nicht bei uns, auch nicht in der EU. Wenn ich bestehende Systeme umstelle und dafür andere Metalle benötige, erzeuge ich eine Nachfrage nach diesen Metallen. Der EU Critical Raw Materials Act fordert, dass ab 2030 zehn Prozent der sogenannten technisch-strategischen Metalle in Europa erzeugt werden sollen, 40 Prozent des Bedarfs in Europa sollen aus dem Recycling gedeckt werden. Ich sehe in Deutschland keine ausreichenden Forschungskapazitäten in dem Bereich. Wird die Frage der Rohstoffverbräuche mitgedacht oder nicht, wenn wir über Strategien für Antriebstechnologien diskutieren?
Uhlmann:
Die müssen wir natürlich mitdenken. Für die Wasserstoffdirektverbrennung zum Beispiel werden austenitische Stähle benötigt oder auch spezielle Beschichtungen, die wir heute bereits beherrschen. Die Technologien, diese Werkstoffe herzustellen, sind verfügbar. Das ist überhaupt keine Frage. Wir brauchen aber neue Werkstoffe, beispielsweise um einen Elektromotor Neodym-frei zu machen. Neodym ist eine Seltene Erde, die wir möglichst vermeiden wollen. Da sind wir genau an dem Punkt, den Sie gerade benennen, dass wir alternative Werkstoffe entwickeln müssen.
Schwarz:
Mein beruflicher Schwerpunkt waren neben dem aktuellen Thema der E-Fuels in den letzten 40 Jahren die sogenannten Seltenen-Erden-Lagerstätten. Und da komme ich zu der Frage: Wir wissen heute, dass die Umsetzung bestimmter politischer Vorgaben der letzten 10, 15 Jahre in Deutschland und Europa zumindest länger dauern wird, als man damals dachte. Sie sprechen jetzt von den Neodym-freien Motoren. Wie lange wird es dauern, bis Sie diese Werkstoffe entwickelt haben, bis sie in den Mengen produziert werden, die wir benötigen? Wann stehen diese Technologien aus Ihrer Sicht im industriellen Maßstab zur Verfügung, sodass wir damit auch Autos betreiben können?
Uhlmann:
Kennen Sie den ersten Hauptsatz der Maschinenbauer?
Schwarz:
Nein.
Uhlmann:
Der Hauptsatz der Maschinenbauer heißt: Wer nicht anfängt, wird nicht fertig. Das Problem ist, dass wir mit bestimmten Dingen nicht anfangen. Wir tun so, als müsste alles schon da sein, bevor wir in eine Technologie hineingehen, anstatt sie interdisziplinär zu erforschen und zu entwickeln. Deswegen insistiere ich auch in der Politik, dass, wenn wir die Wasserstoffdirektverbrennung verfolgen wollen, wir auch über Werkstoffe nachdenken müssen.

Blumenröder:
Sie haben grundsätzlich recht. Das Thema der Materialien ist bei der Wasserstoffdirektverbrennung aber das geringste Problem. Stattdessen: einfach machen! Dann kann man sich darüber streiten, wie man die Wasserstoffverbrennung umsetzt. Man muss ein Brennverfahren auswählen, das tatsächlich sicher ist. Bisher sind von allen Motorenherstellern Wege verfolgt worden, die mit einem Zündstrahlverfahren funktionieren, das den Nachteil hat, dass man Benzin oder Diesel zuführt und damit keine CO2-freie Verbrennung realisiert. Das wird dann in der europäischen Regulation auch nicht gefördert.
Uhlmann:
Dann müssen wir eine technische Lösung finden und Injektoren entwickeln, die Wasserstoff einspritzen können. Die Technologien sind zumindest schon angedacht und auch teilweise umgesetzt. Unser Problem in Deutschland ist doch, dass wir politisch oft auf nur eine Technologie fokussieren und alles andere ausblenden. Das müssen wir einerseits aufbrechen und andererseits fragen, in welcher Folgelogik, in welcher Timeline muss was erfolgen? Sie, Herr Schwarz, sehen für E-Fuels Potenziale im Luftverkehr. Dort sind sie jetzt schon eine Voraussetzung. Aber sind E-Fuels im Straßenverkehr für Sie ein Thema, auch im Sinne der Bestandsfahrzeuge und vor dem Hintergrund der Kosten?
Schwarz:
Wenn wir den Gedanken der Zeit einpreisen, sehe ich natürlich die E-Fuels als Brückentechnologie, auch im Straßenverkehr. Die kann ich sofort herstellen. Wenn ich die Rahmenbedingungen ändere, die den Strompreis belasten, dann kann ich sie auch wirtschaftlich herstellen. Dann fällt aber immer noch CO2 an. Da bin ich bei einem Punkt, den wir noch nicht berührt haben: Was machen wir eigentlich mit dem CO2? Und warum sind wir politisch dagegen, CO2 an Punktquellen abzuziehen und als Wertstoff stofflich zu nutzen? Andere Länder haben bereits Geschäftsmodelle, um CO2 aufzufangen und zwar an Stellen, wo es in Größenordnung-Mengen anfällt. Ein anderer Punkt: Die Amerikaner haben vor vier Jahren entschieden, dass das Verteidigungsministerium de facto zu jedem Preis jedes synthetische Kerosin kauft, das über verschiedenste neue Technologiepfade hergestellt wird. Und sie werden jetzt entscheiden, welche zwei oder drei dieser neuen Technologiepfade sie massiv in der industriellen Umsetzung fördern werden. Das ist eine technologieoffene Förderung, die wir hier in Deutschland nicht haben, aber dringend benötigen
Uhlmann:
Richtig, wir müssen aber unterschiedliche Transformationswege gehen und verschiedene Technologieansätze verfolgen, um zu emissionsfreien Antrieben zu gelangen.
Blumenröder:
»Electric only« wird auch in Zukunft nicht für alle Anwendungen sinnvoll sein. Wir werden einen Mix aus unterschiedlichen Antriebstechnologien haben, die wir auch von »Cradle to Grave«, von der Wiege bis zur Bahre denken und umsetzen müssen, wenn wir eine CO2-neutrale Mobilität erreichen wollen. Der Mix dieser Technologien wird je nach Anwendung und Infrastruktur unterschiedlich aussehen, aber von den Synergieeffekten zwischen den verschiedenen Ansätzen werden alle profitieren.
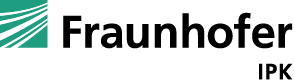 Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik